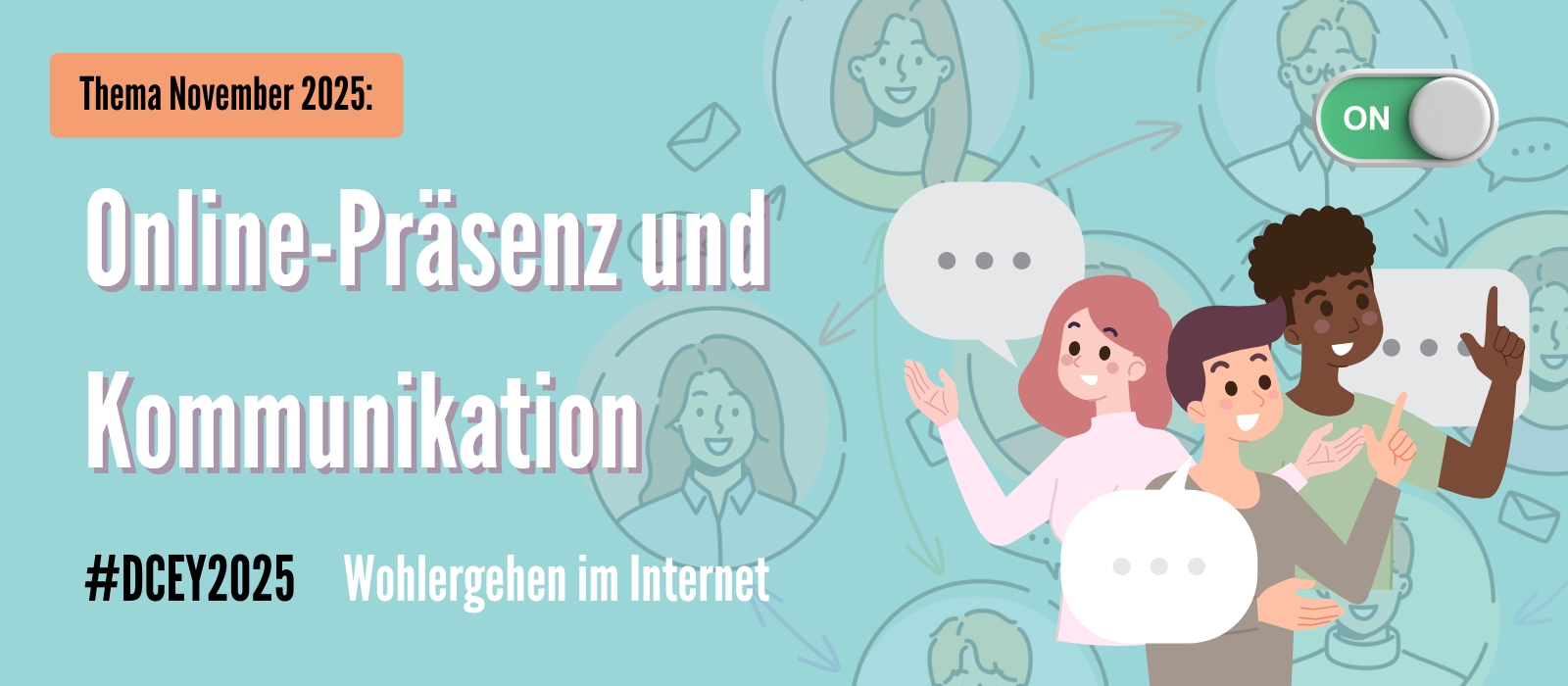
Wann immer wir online sind, hinterlassen wir Spuren. Die Gesamtheit dieser Spuren wird als digitaler Fußabdruck bezeichnet. Er umfasst aktiv hinterlassene Spuren wie Videos, Bilder oder Posts in Sozialen Netzwerken wie auch passive Spuren in Form von automatisch gesammelten Daten über uns wie IP-Adressen und deren Standorte, Geräteinformationen oder Suchverläufe.
- Die Online-Präsenz bezeichnet das gesamte Auftreten und die Sichtbarkeit einer Person, Organisation oder Marke im Internet – also die aktiven Spuren, die von uns selbst oder anderen hinterlassen werden.
- Die Online-Kommunikation hingegen beschreibt die Praxis, wie wir im Moment online interagieren.
Man könnte sagen: Die Online-Präsenz umfasst die Spuren, die wir hinterlassen, während die Online-Kommunikation den Weg beschreibt, den wir dabei einschlagen.
In einer analogen Welt, die zunehmend von der digitalen strukturiert wird, sind Online-Präsenz und -Kommunikation von großer Bedeutung. Nicht umsonst ist häufig von der digitalen Visitenkarte die Rede. Gerade im Hinblick auf das Berufsleben können unbedachte Posts in sozialen Netzwerken oder frei zugängliche private Fotos weitreichende Konsequenzen haben. Verstärkt wird dieses Problem dadurch, dass es oft schwierig ist, Inhalte endgültig zu löschen – denn das Internet vergisst nicht. Ob durch Reposts von Bildern oder Videos, durch Screenshots, die andere anfertigen und veröffentlichen, oder durch Webarchive wie die Wayback Machine: Je mehr Aufmerksamkeit ein Inhalt erzeugt, desto schwieriger lässt er sich entfernen.
Dazu kommt, dass Inhalte in Sozialen Netzwerken, die bei NutzerInnen Empörung hervorrufen, schnell sehr viel Aufmerksamkeit bekommen können. Denn wenn sich diese Emotion in negativen Kommentaren entlädt, so bringt die hohe Interaktionsquote den Algorithmus dazu, den Inhalt mehr Menschen anzuzeigen. Dadurch kommt mehr Empörung zustande und eine selbstverstärkende Dynamik kommt in Gang. Dieses Phänomen einer Flut an negativen Kommentaren nennt man Shitstorm.
|
Beispiel: Der Fall des Drachenlords
Beispielhaft für eine fatale Online-Kommunikation und -Präsenz ist die kontroverse Figur des "Drachenlords": Rainer Winkler, alias Drachenlord, ein deutscher YouTuber, wurde durch den Konflikt mit einer großen Zahl an Online-Trollen und seine Selbstdarstellung im Internet bekannt. Nachdem er in einem Video im Jahr 2014 seine Adresse veröffentlichte, kursierte diese trotz Löschung weiterhin im Netz. Immer wieder versammelten sich Personen vor seinem Haus, um ihn zu belästigen. Selbst im Jahr 2025 als Rainer Winkler nicht mehr an dieser Adresse wohnte, harrten bis zu 4 000 Menschen an der Ortsgrenze. Winklers Fehler im Jahr 2014 führte zu jahrelangem Cybermobbing, realer Belästigung und wiederkehrender Medienberichterstattung.
Solche drastischen Fälle führen vor Augen, wie wirkmächtig die eigene Online-Präsenz ist, da die Reichweite von Inhalten im Netz bei entsprechender Aufmerksamkeit extrem hoch werden kann. Auch wenn diese eher die Ausnahme als die Regel sind, zeigen sie, dass gewisse Grundregeln in der Online-Kommunikation beachtet werden sollten. Unter anderem deshalb, weil sich Beleidigungen wesentlich leichter auf einer Tastatur schreiben lassen, als sie von Angesicht zu Angesicht auszusprechen.
|
Aufgrund der zunehmenden digitalen Mediatisierung, das heißt der Durchdringung unserer Gesellschaft mit digitalen Medien, und dem damit einhergehenden Wandel unserer Kommunikationsgewohnheiten, sollte ein bewusster, reflexiver und sozial kompetenter Umgang mit eben diesen Medien gefördert werden. Dies stellt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe dar, die nicht nur durch schulisches Lernen bewältigt werden kann und deren Zielgruppe außerdem nicht ausschließlich junge Menschen sind. Allerdings kann Schule einen Beitrag leisten, um eine bewusste und verantwortungsvolle Online-Kommunikation zu implementieren.
Konkrete Anknüpfungspunkte:
- Wie Medienformen Kommunikation formen: Vergleich zwischen Schrift, Schrift mit Emojis und Memes
- Würdest du das Jemandem ins Gesicht sagen? Szenische Lesung von hitzigen Debatten in Sozialen Medien als Ausgangspunkt für eine Reflexion über Unterschiede im offline und online Kommunikationsverhalten
- Was teile ich mit wem? Lernende ordnen fiktionale Posts oder Fotos verschiedenen Kategorien zu: Öffentlich, Freunde, Familie oder Datensafe
- Privatsphäre-Challenge: Die Lernenden prüfen, wie viele private Informationen sie aus öffentlich zugänglichen Online-Quellen über sich finden. Danach werden Strategien zum Schutz der Privatsphäre umgesetzt.
- Das Internet vergisst nicht: Digitale Zeitreise ins Internet der 1990er-Jahre mit der Wayback Machine
|
Lehr-Lern-Setting: Die digitale Visitenkarte checken
Die SchülerInnen analysieren die Online-Präsenz ihrer PartnerInnen und werten diese in Hinblick auf zukünftige Bewerbungen aus. Darauf aufbauend formulieren sie eine Beurteilung der Online-Präsenz im Rahmen eines Rollenspiels. Abschließend reflektieren die SchülerInnen gemeinsam ihre Online-Präsenz und zukünftige Online-Kommunikation.
Hier geht es zum Lehr-Lern-Setting.
|
Materialsammlung
-
Andreas Kirchwitz. Die Netiquette (2006), www.kirchwitz.de/~amk/dni/netiquette
-
Bundeszentrale für politische Bildung, Audiobeitrag: Sektion 2: Emotionen im Netz: Entfesselte Kommunikation? (2019), www.bpb.de/mediathek/audio/287217/sektion-2-emotionen-im-netz-entfesselte-kommunikation
-
explainity® Erklärvideo, Gefahren sozialer Netzwerke einfach erklärt (04:45), www.youtube.com/watch?v=8VVIqRlo7ig
-
Google, Interland (2024), https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us/interland
-
Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, Kommunikation im Netz. Für einen respektvollen Umgang im Internet (2020), https://bitte-was.de/fileadmin/Redaktion/downloads/Lehrmaterialien-Gesamtversionen/Kommunikation_im_Netz-Gesamtversion.pdf
-
Medien in der Schule, Modul 2 – Kommunikation im Netz mit Unterrichtsplanungen, www.medien-in-die-schule.de/unterrichtseinheiten/jugendliche-online/modul-2-kommunikation-im-netz/
-
Regeln für Eltern in Bezug auf Kinder im Kindergartenalter und Online-Kommunikation https://medienkindergarten.wien/medienpaedagogik/infothek/netiquette-40-verhalten-im-internet-und-in-der-digitalen-kommunikation
-
Saferinternet, Dossier: Datenspuren im Netz (2019), www.saferinternet.at/news-detail/datenspuren-im-netz-was-die-digitale-welt-ueber-mich-weiss