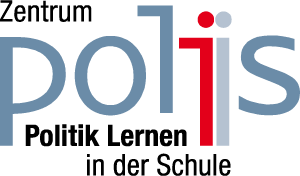Wer macht welche Arbeit?
| Dauer | 2 Unterrichtseinheiten |
| Schulstufe | 11. bis 13. Schulstufe |
| Zielsetzungen |
Sensibilisierung für gesellschaftliche Wertzuschreibungen von Arbeit, Analyse von rassistischer und sexistischer Diskriminierung |
|
Lehrplanbezug
|
Geschichte und Politische Bildung, Unterrichtsprinzip Politische Bildung |
| Kompetenzen | Handlungskompetenz, Urteilskompetenz |
| Materialien | Plakate, Karten, Stifte |
| Methoden | Reflexion, Diskussion |
| Autorin/Quelle | |
| Aktualisiert | 01.05.2024 |
Ablaufbeschreibung
1. Schritt: Sortieren (20 Minuten)
Die SchülerInnen werden in drei Gruppen aufgeteilt und bekommen jeweils einen Stapel von zehn bis zwölf Berufen. Sie bekommen die Aufgabe, die Berufskarten entsprechend dem Sortierkriterium ihres Arbeitsauftrages (siehe Kopiervorlage) in eine bestimmte Reihenfolge zu bringen. Auf separaten Karten sollen sie Gründe für die von ihnen gewählte Reihenfolge sammeln. Wichtig: Die Gruppen sollten zunächst nur ihren eigenen Arbeitsauftrag kennen.
2. Schritt: Diskussion (20 Minuten)
Sind die Gruppen damit fertig, werden die drei Kartenreihen kommentarlos nebeneinandergehängt, ohne zu verraten, welches Sortierkriterium der Reihenfolge zugrunde liegt. Die SchülerInnen vergleichen die Kartenreihen, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten festzustellen. Im Anschluss können Vermutungen über das Sortierkriterium der anderen geäußert werden. Danach präsentieren alle Gruppen nacheinander ihr Sortierkriterium und ihre Begründungen, die sie auf Karten festgehalten haben. Nun werden die Ergebnisse erneut diskutiert. Die Unterschiede in der Reihenfolge der Karten in den Gruppen sollen eine Diskussion über das Spannungsfeld von Sinn, gesellschaftlicher Wertzuschreibung und Entlohnung von Tätigkeiten anregen. Dabei sollte die Aufmerksamkeit vor allem auf Ursachen, Gründe und allgemeine gesellschaftliche Begründungsmuster gelenkt werden.
3. Schritt: Sortieren II (20 Minuten)
Nun bilden die SchülerInnen zwei Kleingruppen und erhalten nochmals die Berufskarten mit dem Auftrag, die Berufe nach dem Anteil von Frauen bzw. MigrantInnen zu ordnen (siehe Kopiervorlage). In einem zweiten Schritt notieren die SchülerInnen mögliche Gründe für einen hohen bzw. niedrigen Anteil auf separaten Karten.
4. Schritt: Auswertung (20 Minuten)
Wieder werden die zwei Kartenreihen zunächst kommentarlos aufgehängt. Die SchülerInnen werden aufgefordert, die beiden Reihen miteinander zu vergleichen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. Nachdem kurz Vermutungen geäußert werden können, welche die beiden Sortierkriterien waren, präsentieren die Kleingruppen ihr Kriterium und die auf separaten Karten notierten Gründe für einen hohen bzw. niedrigen Anteil. Nun kann zusammen diskutiert werden, welche die gemeinsamen und welche die spezifischen Ursachen für einen hohen bzw. niedrigen Anteil von Frauen bzw. MigrantInnen sind. Auch die Frage, wie sich die doppelte Diskriminierung auf Migrantinnen (als Frau und als Migrantin) auswirkt, sollte diskutiert werden.
5. Schritt: Zusammenführung (20 Minuten)
Nun werden alle fünf verschiedenen Reihen verglichen. Folgende Fragen können die Schlussdiskussion anleiten:
- Gibt es Parallelen zwischen dem Anteil von Frauen/MigrantInnen und der Reihenfolge der Entlohnung?
- Wie hängen die gesellschaftliche Wertschätzung und der Anteil von Frauen/MigrantInnen zusammen?
- Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Wichtigkeit von Tätigkeiten und dem Anteil von Frauen/MigrantInnen?
- Wie könnten die Ursachen für die Benachteiligung von Frauen und MigrantInnen abgebaut werden?
- Welche Möglichkeiten gibt es für soziale Initiativen, die Position von Frauen und MigrantInnen zu verändern?
Kopiervorlage
Wer macht welche Arbeit? [PDF, 600 kb]
Link- und Medientipps
- Politiklexikon für junge Leute: Arbeitslosigkeit | Arbeitsmarkt/Arbeitsmarktpolitik | Arbeitsrecht | Gewerkschaft | Sozialpartnerschaft
- polis aktuell 4/2024: Gleiche Arbeitsrechte für alle!
- Richtig & Falsch – Podcast für Politische Bildung