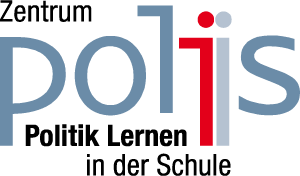Wählen ab 14?
| Dauer | 1-2 Stunden |
| Schulstufe | 5.-13. Schulstufe |
| Methoden | Diskussion, Stellungnahme |
| Materialien |
Pro Gruppe ein Flipchart Papier, Sammlung von Argumenten |
| Kompetenzen | Methodenkompetenz, Urteilskompetenz |
| Zielsetzungen | Die SchülerInnen setzen sich mit Argumenten für und gegen eine Senkung des Wahlalters auseinander. |
| Lehrplanbezug | Politische Bildung |
| Quelle |
Zentrum polis (Hrsg.): Nationalratswahlen und Wahlrecht in Österreich, polis aktuell 7/ 2006. |
| Aktualisiert | 26.03.2022 |
Ablaufbeschreibung
Die SchülerInnen setzen sich mit der Frage auseinander, was aus ihrer Sicht für bzw. gegen eine Senkung des Wahlalters von 16 auf 14 Jahren spricht.
Schritt 1:
Spontane Stellungnahme (1 Min.)
Jeder Schüler/jede Schülerin schreibt nach einer kurzen Zeit der Überlegung ein "ja" oder "nein" auf einen kleinen Zettel, ob er/sie sich für eine Wahlaltersenkung auf 14 auspricht oder nicht und legt diesen beiseite.
Schritt 2:
Argumente in der Gruppe sammeln (20 Min.)
Die SchülerInnen teilen sich in Gruppen zu drei bis vier Personen. Jede Gruppe erhält einen Flipchartbogen mit zwei Spalten. In der linken Spalte sollen Argumente für eine Senkung des aktiven Wahlalters auf 14 Jahre gesammelt werden, in der rechten Spalte Argumente dagegen.
Schritt 3:
Präsentation der Argumente in der Klasse (1 Min./Gruppe)
Jede Gruppe hängt ihren Flipchartbogen auf und liest die Argumente vorl und wenn nötig erläutert diese.
Schritt 4:
Klassendiskussion (10 Min.)
Nun besteht die Möglichkeit, einzelne Argumente zu hinterfragen und zu kritisieren. Die Mitglieder der Gruppe, von der das Argument stammt, sollen darauf reagieren.
Es kann passieren, dass SchülerInnen Argumente gegen ein Wahlrecht von Kindern anführen, die jenen sehr ähnlich sind, die in der Mitte des 20. Jahrhunderts gegen das Wahlrecht von Frauen verwendet wurden . Eine Sammlung solcher Argumente steht für die Lehrkraft unter "Downloads" zur Verfügung.
Schritt 5:
Kompetenzen sammeln (10 Min.)
Im Verlauf der allgemeinen Diskussion wird sich bald herausstellen, dass es weniger um die Frage des Alters geht, sondern welche Kompetenzen (verantwortungsbewusst, politisch interessiert, selbständig, kritikfähig, unabhängig etc.) eine Person aufweist, die wählen geht. Die Lehrperson sammelt die genannten Kompetenzen an der Tafel /Whiteboard etc.)
Schritt 6:
Abstimmung über die Eigenschaften eines/einer Wahlberechtigten (3 Min.)
Zu jeder der gesammelten Kompetenzen erfolgt eine kurze Abstimmung. Die SchülerInnen entscheiden, welche Kompetenzen für eine wahlberechtigte Person idealtypisch wären.
Ergebnis der Abstimmung ist somit das "idealtypische Profil" eines Wählers/einer Wählerin. Welche Kompetenzen sind davon altersabhängig?
Schritt 7:
Die SchülerInnen überlegen, inwieweit sich die Antwort bzgl. Wahlaltersenkung, die sie am Anfang der Übung auf den Zettel geschrieben haben, verändert hat und wenn ja, warum.
Download
Sammlung von Argumenten gegen das Wahlrecht von Kindern (für die Lehrkraft)
Links + Medientipps
Themendossier: Wahlen
polis aktuell 2/2022: Wahlen | Wählen
Politiklexikon für junge Leute: Jugendbeteiligung | Wahlrecht
Zeitleiste erstellt durch das Demokratiezentrum Wien: Wahlrechtsentwicklung von 1848 bis heute