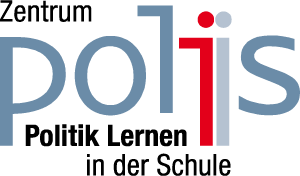Schulnahbereich erkunden – Grätzeldetektive
| Dauer | 2-4 Unterrichtseinheiten |
| Schulstufe | ab der 7. Schulstufe (aufgrund von Aufsichtspflicht und Verlassen des Schulgebäudes; siehe dazu §44a SchUG) |
| Methoden |
Beobachtung, empirische Daten erheben |
| Material |
Smartphones mit mobilen Daten; App Google Maps; aktiver Google-Account |
| Kompetenzen |
Partizipationsstufe: Mit-Sprache |
| Zielsetzungen | Die SchülerInnen partizipieren aktiv auf kommunaler Ebene |
| Lehrplanbezug |
Übergreifendes Thema Politische Bildung |
| Autor | Lorenz Prager |
| Aktualisiert | 20.8.2025 |
Ablaufbeschreibung
- Briefing: Die SchülerInnen erhalten einen kurzen Input der Lehrkraft zum Ablauf des Projekts, der Dokumentation von Anliegen und den Zuständigkeiten einer Gemeinde, damit sie wissen, welche Dinge sie während der Erkundungstour in den Blick nehmen (beispielsweise: Flächennutzung und Verkehrspolitik).
- Erkundungstour: Die SchülerInnen erkunden in Gruppen den Nahbereich der Schule. Wenn sie Änderungswünsche haben, beispielweise einen Fahrradständer vor der Schule möchten oder sich die Begrünung einer Straße wünschen, fotografieren sie den Ort und speichern die GPS-Position über Google Maps.
- Präsentation- und Abstimmung: Die SchülerInnen bereiten in ihren Gruppen eine Präsentation ihrer drei dringlichsten Änderungswünsche vor und präsentieren diese vor der Klasse. Nachdem alle Gruppen präsentiert haben, wird über die Vorschläge abgestimmt. Dazu kann ein digitales Tool (z.B. Mentimeter) oder eine analoge Methode (z.B. Markierungspunkte, die neben Vorschläge geklebt werden) verwendet werden.
- Ausarbeitung und Übergabe: Die drei Vorschläge oder Änderungswünsche, die die meisten Stimmen bekommen haben, werden arbeitsteilig weiter aufbereitet und an die zuständige Kommunalverwaltung übergeben. Dabei kann ein persönlicher Termin mit dem/der BürgermeisterIn oder BezirksvorsteherIn organisiert werden oder es können, falls vorhanden, online Tools wie die App Sag‘s Wien (mehr Infos unter: www.wien.gv.at/sagswien) benutzt werden.
- Debriefing: Der gesamte Prozess wird zuerst in den Gruppen und dann im Plenum besprochen und reflektiert. Der Zeitpunkt hierzu kann unterschiedlich gewählt werden: Entweder direkt nach der Übergabe der Anliegen oder nachdem eine Antwort oder Reaktion der betreffenden Kommune eingegangen ist. Dabei sollte sowohl auf die inhaltliche Ebene ( z.B: Was konnten wir bewirken? Was ist passiert oder wird passieren?) als auch auf die emotionale Ebene (Was war erfreulich? Was war frustrierend oder ärgerlich?) eingegangen werden. Als Abschluss der Reflexion bietet sich eine Blitzlicht-Runde zur Frage „Was konnten wir daraus lernen?“ an.