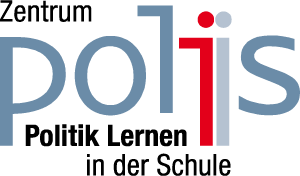Diskriminierende Sprache erkennen und Alternativen dafür finden
| Dauer | 1 Unterrichtseinheit |
| Schulstufe | 8.-13. Schulstufe |
| Methoden |
Brainstorming in Kleingruppen, Diskussion im Plenum; für die Vertiefungsaufgabe: Medienanalyse |
| Materialien | Tafel/Plakat; für die Vertiefungsaufgabe: Zeitungen und Zeitschriften |
| Kompetenzen | Urteilskompetenz, Methodenkompetenz, Handlungskompetenz |
| Zielsetzungen | Diskriminierende und rassistische Alltagssprache erkennen und Alternativen dazu finden |
| Lehrplanbezug | Deutsch, Politische Bildung |
| Autorin/Quelle | Maria Haupt, polis aktuell 2015/01: Sprache und Politik |
| Erstellt | 24.01.2022 |
Ablaufbeschreibung
1. Die SchülerInnen sammeln in Kleingruppen Beispiele für diskriminierende, beleidigende und rassistische Sprache, die sie aus ihrem Alltag, aus der Schule, den Medien oder der Politik kennen. Machen Sie vorab deutlich, dass die SchülerInnen gerne auch persönliche Erlebnisse einbringen können, das aber keine Bedingung für die Übung ist.
2. Teilen Sie die Tafel in zwei Hälften und lassen Sie anschließend die SchülerInnen die von ihnen gefundenen Begriffe und Redewendungen unter der Überschrift „Beispiele für diskriminierende/rassistische Sprache …“ untereinander auf der einen Hälfte der Tafel notieren.
3. Diskutieren Sie gemeinsam die notierten Begriffe und Redewendungen.
Anregungen für die Diskussion:
- Was könnten Gründe dafür sein, dass Menschen diese Wörter und Begriffe als diskriminierend, abwertend, ausgrenzend oder verletzend empfinden?
- Werden diese Begrifflichkeiten eurer Meinung nach ausschließlich mit der Absicht verwendet, um andere zu verletzen und auszugrenzen? Was könnten weitere Gründe dafür sein?
- Welche dieser Bezeichnungen habt ihr selbst schon einmal verwendet oder selbst erfahren und wie fühlt sich das an? (Achten Sie darauf, dass diese Frage ausschließlich von Freiwilligen beantwortet wird.)
- Glaubt ihr, dass es schwierig ist, Alternativen für die gesammelten Begriffe zu finden und anzuwenden?
4. Die SchülerInnen sammeln nun auf der zweiten Tafelhälfte Alternativen für die abwertenden oder diskriminierenden Begrifflichkeiten (z.B. AsylbewerberIn statt AsylantIn, Roma und Sinti statt ZigeunerIn, Menschen mit Behinderung statt Behinderte etc.).
Ideen für mögliches Weiterarbeiten:
Variante 1: Diskutieren Sie mit den SchülerInnen Möglichkeiten, die zuvor erarbeitete nichtdiskriminierende und nicht-rassistische Sprache in der Schule und in ihrem Alltag umzusetzen. Sammeln Sie gemeinsam Ideen (z.B. ein Sprach-Handbuch für die Klasse erstellen, einen Sketch im Schultheater aufführen, Sprachplakate in den Klassenzimmern aufhängen etc.). Anschließend stimmt die Klasse darüber ab, welche der Ideen umgesetzt werden sollen.
Variante 2: Zum Weiterarbeiten bietet sich an, die SchülerInnen in Kleingruppen und über einen Zeitraum von ein bis zwei Wochen diskriminierende und rassistische Äußerungen in Printmedien, Werbung, Schule und Alltag zusammentragen zu lassen und diese anschließend in der Klasse zu präsentieren. Als einen weiteren Schritt könnten die SchülerInnen auch einen Leserbrief an jene Zeitungen und Zeitschriften verfassen, welche abwertende oder diskriminierende Begrifflichkeiten verwenden und diese darin auf mögliche Alternativen hinweisen.
Link- und Medientipps
Politiklexikon für junge Leute: Diskriminierung | Hate Speech/Hassrede | Rassismus | Vorurteil
polis aktuell 5/2021: Sprachenrechte
Dossier: Aktiv gegen Hass im Netz
No Hate Speech Komitee Österreich: www.nohatespeech.at