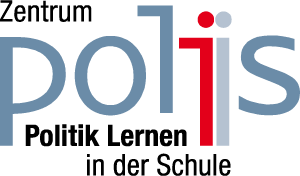Wer entscheidet, was wir sehen? Algorithmen in Sozialen Medien
|
Dauer |
1 Unterrichtseinheit |
|
Schulstufe |
ab der 9. Schulstufe |
|
Methoden |
Semantisches Differential, Gruppenpuzzle, Gruppenpräsentation |
|
Material |
Arbeitsblatt, internetfähiges Gerät (Smartphone, Tablet oder Laptop), Kopfhörer |
|
Kompetenzen |
Geschichte und Politische Bildung: politikbezogene Methodenkompetenz, politische Urteilskompetenz |
|
Zielsetzungen |
Die SchülerInnen beschreiben Algorithmen, beurteilen wie sie sich auf die Sichtbarkeit von Inhalten in Sozialen Medien auswirken und reflektieren, wie sich diese auf politische Diskurse und ihre eigene Meinungsbildung auswirken. |
|
Lehrplanbezug |
Geschichte und Politische Bildung: Kompetenzmodul 5: Medial vermittelte Informationen kritisch hinterfragen (Einfluss der mediealen Präsentationsformen reflektieren, unzulässige Vereinfachung möglicher Aussagen erkennen, unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten erörtern) |
|
Autor |
Lorenz Prager |
|
Aktualisiert |
30.3.2025 |
|
|
Didaktische ÜberlegungenDas vorliegende Lehr-Lern-Setting widmet sich der Rolle von Algorithmen in Sozialen Medien bei der Auswahl und Gewichtung von Inhalten. Da Medien als zentrale Informationsquellen maßgeblich zur Meinungsbildung in Demokratien beitragen, berührt diese Unterrichteinheit sowohl politikbezogene Methodenkompetenz als auch politische Urteilskompetenz. Die Lernenden setzen sich kritisch und auf einer Metaebene mit digitaler Kommunikation auseinander, analysieren Funktionsweisen und formulieren darauf aufbauend politische Urteile zum betrachteten Phänomen. Damit entsteht ein klarer Dreischritt:
Laut der JIM-Studie 2024 nutzen zwei Drittel der Jugendlichen regelmäßig YouTube; eine Forsa-Umfrage zeigt, dass 93 % der Jugendlichen täglich Soziale Netzwerke wie Instagram oder TikTok verwenden. Das Lehr-Lern-Setting knüpft damit an die unmittelbare Lebenswelt der Lernenden an.
Eng verbunden mit diesem Lebensweltbezug ist die Subjektorientierung, die hier in zweifacher Weise erfüllt wird: Zum einen durch die Verknüpfung der individuellen Erfahrungswelt (Subjektebene) mit der fachlichen Analyse digitaler Medien (Objektebene), zum anderen durch das Aufgreifen der vorhandenen Einstellungen und des Vorwissens der Lernenden – sichtbar gemacht durch den aktivierenden Einstieg über das semantische Differential. |
Ablaufbeschreibung
Einstieg (etwa 10 Minuten)
Führen Sie mit der Klasse ein semantisches Differential zu Algorithmen in Sozialen Medien durch. Diese aktivierende Methode macht die Vorstellungen der Lernenden zu einem Gegenstand, Begriff oder Phänomen sichtbar. Dazu werden Gegensatzpaare von Adjektiven gebildet, die den Gegenstand beschreiben – etwa: Sind Algorithmen in Sozialen Medien gefährlich oder harmlos? Die Schülerinnen und Schüler verorten ihre Meinung anschließend auf einer Skala. Bitten Sie dann einzelne Lernende ihre Positionierung zu begründen.
Das Verfahren kann auf unterschiedliche Weise umgesetzt werden: Entweder mit zwei Polen (z.B. gefährlich oder harmlos) im Klassenraum, zwischen denen sich die Lernenden positionieren müssen (durch die Bewegung kommt mehr Dynamik ins Geschehen und die Klasse wird meist stärker aktiviert). Oder in digitaler Form, zum Beispiel über Mentimeter oder ein ähnliches Abstimmungstool.
Eine Vorlage für ein semantisches Differential zu Algorithmen in sozialen Medien finden Sie am Ende der Ablaufbeschreibung.
Gruppenpuzzle Phase I: Recherche (etwa 15 Minuten)
Teilen Sie die Lernenden in vier möglichst gleich große Gruppen (a, b, c, d) auf und erklären Sie ihnen den Ablauf des Gruppenpuzzles.
- In der Stammgruppe wird zunächst recherchiert, die Ergebnisse werden zusammengefasst und auf dem Arbeitsblatt festgehalten.
- Anschließend treffen sich die Lernenden in ExpertInnengruppen, tauschen ihre Ergebnisse aus und diskutieren sie.
- Jede ExpertInnengruppe erstellt eine kurze Zusammenfassung, die sie in maximal zwei Minuten der gesamten Klasse präsentiert.
Lassen sie die Lernenden mit ihrer Recherche beginnen und unterstützen sie Gruppen, die Hilfe benötigen. Jede Stammgruppe recherchiert online zu denselben Themen, allerdings mit unterschiedlichen Medien:
- Gruppe a) sieht sich ein YouTube-Video an (Titel: Das Problem mit den Algorithmen | MedienWissen2go)
- Gruppe b) recherchiert auf Instagram oder TikTok
- Gruppe c) recherchiert mit generativer KI
- Gruppe d) recherchiert auf Wikipedia zu den Begriffen: Filterblase, Soziale Netzwerke (insbesondere Abschnitt Kritik), Algorithmus, Clickbait
Gruppenpuzzle Phase II: Abstimmung und Präsentation (etwa 15 Minuten)
Leiten Sie nach etwa zehn Minuten den Wechsel in die ExpertInnengruppen ein. Erinnern Sie die Lernenden noch einmal daran, dass sie nun ihre unterschiedlichen Ergebnisse austauschen sollen und gemeinsam eine Zusammenfassung zur Präsentation vorbereiten sollen.
Diskussion (etwa 10 Minuten)
Zum Abschluss der Einheit wird das semantische Differential wiederholt allerdings nur mit den fett markierten Paaren der Vorlage (gefährlich – harmlos, gerecht – ungerecht, demokratisch – undemokratisch). Fragen Sie die Lernenden, ob sich an ihren Einstellungen etwas verändert hat, und fordern Sie sie auf, ihre Positionierungen zu kommentieren und diskutieren.
Sollte keine Debatte zu Stande kommen, können sie auch folgenden Auszug aus einem Artikel zur Diskussion stellen:
Der Algorithmus spielt den User*innen daher vor allem personalisierte Inhalte aus, die teilweise nicht mehr im Mainstream, sondern auch in Nischen und an Rändern zu verorten sind. Hier besteht nun laut dem Algorithmus-Forscher Jonathan Stray auch die größte Gefahr: TikTok zieht die Nutzer*innen sofort in eine bestimmte Bubble. Je mehr Videos jemand aus einem bestimmten Bereich ansieht, desto mehr bekommt er aus diesem Bereich angezeigt. Was bei niedlichen Katzen- und Tiervideos harmlos scheint, ist bei extremistischen Inhalten oder Verschwörungstheorien fatal.
Aus: Warum der TikTok-Algorithmus gefährlich ist, 27.07.2021 https://futurezone.at/netzpolitik/tiktok-algorithmus-gefahr-social-media-filterbubble/401455984
Vorlage Semantisches Differential
Algorithmen in Sozialen Medien sind …
|
Eigenschaft 1 |
Positionierung zwischen "stimme Eigenschaft 1 voll zu" und "stimme Eigenschaft 2 voll zu" |
Eigenschaft 2 |
|
gefährlich |
|
harmlos |
|
praktisch |
|
nutzlos |
|
gerecht |
|
ungerecht |
|
demokratisch |
|
undemokratisch |
|
rechts |
|
links |
|
diskriminierend |
|
nichtdiskriminierend |
|
spannend |
|
langweilig |
|
wichtig |
|
unwichtig |
|
klar und deutlich |
|
rätselhaft |
|
einfach |
|
kompliziert |
|
Fortschritt |
|
Rückschritt |