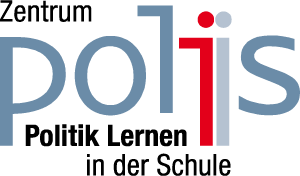Was ist Gewalt?
| Dauer | 1 Stunde |
| Schulstufe | 5.-13. Schulstufe |
| Methoden | Visualisierung des Themenkomplexes Gewalt |
| Materialien |
Zwei größere Zettel, eine dicke Schnur und Situationskarten. Auf den Situationskarten stehen Beispiele von Situationen, die als gewalterfüllt eingestuft werden könnten. Bei jüngeren Kindern (Volksschulalter) können LehrerInnen die Situationen selbst vorgeben und auf die Karten schreiben. Ältere SchülerInnen sollen selbst Gewaltgeschichten, die sie erlebt haben (ob direkt oder nur als BeobachterIn), niederschreiben. |
| Kompetenzen | Urteilskompetenz, Methodenkompetenz |
| Zielsetzungen | Die Übung soll SchülerInnen verdeutlichen, dass es keine Definition von Gewalt gibt, die für alle gleichermaßen gilt, sondern Gewalt immer nur individuell definiert werden kann. |
| Lehrplanbezug | Politische Bildung, Deutsch |
| Quelle | Servicestelle Politische Bildung (nunmehr Zentrum polis) (Hg.): Gewalt in der Familie, info-blatt zur Politischen Bildung, Nr. 2, Mai 2003. |
| Aktualisiert | 18.11.2022 |
Ablaufbeschreibung
Spannen Sie die Schnur über den Boden und markieren Sie mit den beiden größeren Zetteln die beiden Enden als gegensätzliche Pole: "Gewalt", "Keine Gewalt".
Jeder Schüler/jede Schülerin hat nun die Aufgabe, eine Situationskarte (keine, die er selbst beschrieben hat) auf der Schnur zu platzieren – je nach dem wie er/sie die Geschichte einschätzt – näher beim einen oder beim anderen Pol. Sind alle Situationskarten abgelegt, darf jede/r die Position einer Karte verändern, allerdings muss er/sie das vor seinen/ihren Mitschülern und Mitschülerinnen begründen und versuchen, sie zu überzeugen.
Variationsmöglichkeiten
Eine Karte darf nur verschoben werden, wenn entweder alle damit einverstanden sind oder wenn die Mehrheit der Klasse dafür ist. Die Verhandlungen können solange laufen, bis ein Konsens zu allen Situationen gefunden wurde oder jeder Schüler/jede Schülerin wenigstens einmal versucht hat, die Position einer Karte zu verändern. Sollte aufgrund reger Diskussionen eine Unterrichtseinheit nicht ausreichen, können LehrerInnen die Positionen der Karten notieren und als Unterrichtseinstieg in der nächsten Einheit verwenden.
Auswertung
Folgenden Fragen soll nachgegangen werden:
- Gab es Situationen, die einhellig als "Gewalt" eingeschätzt wurden?
- Welche Situationen waren besonders umstritten und warum?
- Was schließen die SchülerInnen daraus?
Folgefragen könnten sein:
- Kann es überhaupt Gewaltfreiheit geben?
- Gibt es legitime Gewalt?
- Warum gibt es ein Gewaltmonopol?
Link- und Medientipps
Politiklexikon für junge Leute: Gewaltschutzgesetz | Gewaltprävention |
Gewalt 2.0/Gewalt im Internet | Gewaltmonopol
polis aktuell 9/21: Tatort Familie. Gewalt gegen Frauen und Kinder
Materialien für die Bearbeitung des Themas Gewalt (www.feel-ok.at,Verein Styria vitalis):
Projekt "Participation for Protection":